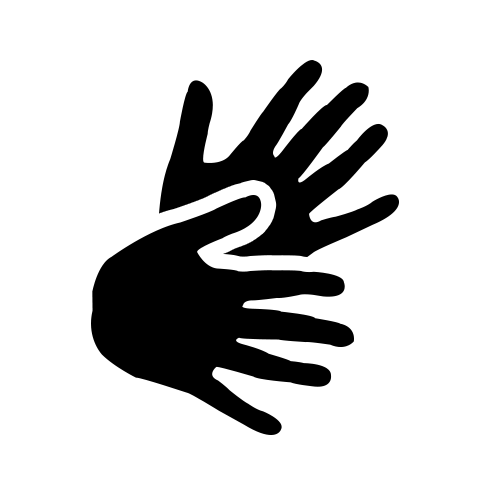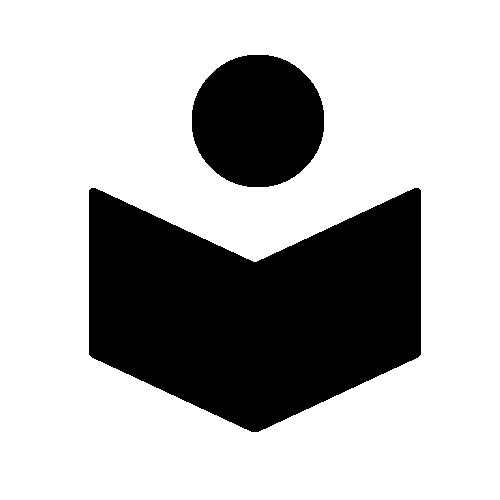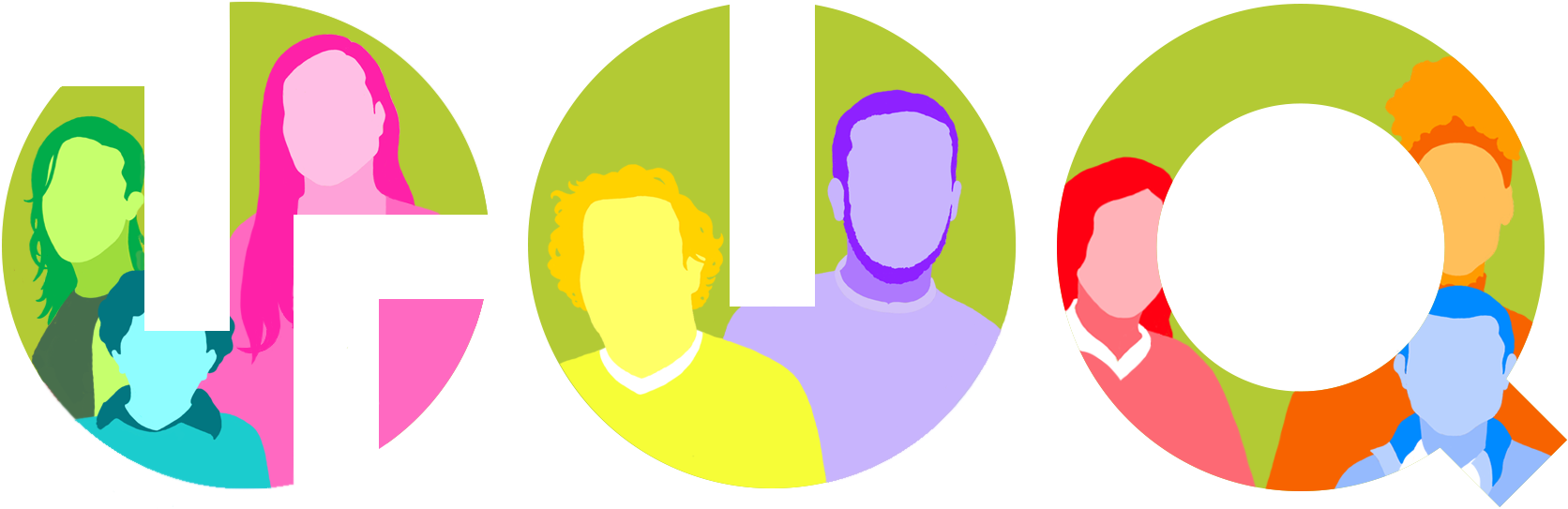FAQ – Wichtige Fragen und Antworten zur Beratung
✉️ Anmerkungen, Ergänzungen oder Fragen gerne an: beratung@transinterqueer.org ✉️
Allgemeines
Begriffe
Trans*, inter* und nicht-binär sind ‚Umbrella Terms‘, übersetzt ‚Regenschirm-Begriffe‘. Sie fassen verschiedene soziale und_oder körperliche Erfahrungen zusammen, die mit Geschlecht zusammenhängen. Die Begriffe cis und dyadisch/endogeschlechtlich fassen ebenfalls geschlechtliche Erfahrungen zusammen.
Trans: Als trans* (adj.) Person bezeichnen sich Menschen, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei Geburt zugewiesen wurde. Das Sternchen steht nach dem Vorbild von Suchmaschinen für eine Vielzahl möglicher Endungen, wie z.B. transgeschlechtlich, transsexuell, transident oder transgender. Weiterlesen…
Cis: Die ursprüngliche Bedeutung der lateinischen Vorsilbe trans ist „jenseits“, ihr Gegenstück ist die Vorsilbe cis, lateinisch für „innerhalb“. Als cis Personen werden Menschen bezeichnet, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei Geburt zugewiesen wurde.
Nicht-binär: Der Begriff „nicht-binär“ wird von einigen als Bezeichnung ihrer Geschlechtsidentität genutzt, dient aber auch als Überkategorie für viele weitere Geschlechtsidentitäten. Diese können „sowohl Mann als auch Frau“, „weder Mann noch Frau“, genderfluid (Personen, deren Geschlechtsidentität sich verschiebt oder flexibel verändert, statt anhaltend gleich zu bleiben) und vieles mehr sein. Weiterlesen…
Inter: Inter* bzw. intergeschlechtlich bedeutet, dass der Körper einer Person nicht den gängigen Vorstellungen von sogenannten „weiblichen“ oder „männlichen“ Körpern entsprechen. Inter* steht für ein breites Spektrum von angeborenen Variationen der Geschlechtsmerkmale. Weiterlesen…
Dyadisch/Endogeschlechtlich: Endo und dyadisch bezeichnet Menschen, die nicht inter* sind, deren körperliche Merkmale also den medizinischen Normvorstellungen von Männern oder Frauen entsprechen. Die Begriffe wurden im Kontext der inter* Bewegung eingeführt, um Normvorstellungen zu hinterfragen. Weiterlesen…
Unterscheidung verschiedener Ebenen (queerer) IdentitätEine gute Grafik zur Unterscheidung von geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung, geschlechtlichem Ausdruck usw. findet ihr hier. Diese Aufteilung ist Hilfsmittel zum Verständnis, in der individuellen Erfahrung können sich Kategorien jedoch auch überschneiden oder identisch sein.
Bandbreite von selbstbeschreibenden Begriffen In verschiedenen Communites gibt es eine große Bandbreite von Begriffen, um geschlechtliche Identität zu beschreiben. Manche Menschen nutzen nur einen dieser Begriffe für ihre Selbstbeschreibung. Andere nutzen verschiedene Begriffe gleichzeitig oder verschiedene je nach sozialem Kontext. Begriffe, die Menschen zur Beschreibung ihrer Geschlechtsidentität nutzen, sind z.B. genderfluid, ageschlechtlich, weder*noch, femme, genderboi, Crossdresser_in, girlfag …
Nicht alle Menschen, auf die diese Erfahrungen (scheinbar) zutreffen, möchten die Begriffe trans*, inter* und_oder nicht-binär für sich nutzen. Manche möchten sich nicht in ein neues Kategorie-System hineinzwängen. Für manche passt ein Begriff nicht gut zu den eigenen Erfahrungen. Manche haben neue Worte für sich gefunden. Manche haben alte Begriffe für sich wiederentdeckt.
Kultureller Bezug und alternative soziale Konzepte Die Begriffe trans, inter und nicht-binär sind im Rahmen einer westlichen binären Kultur entstanden. Das heißt: Die Begriffe machen in einer Kultur Sinn, die generell nur 2 Geschlechter kennt, diese bei der Geburt zuweist und erwartet, dass diese eine konstante Bedeutung für Menschen haben.
In vielen Kulturen gab und gibt es andere geschlechtliche Systeme, mit mehr oder anderen Geschlechtern und jeweiligen sozialen Rollen. In manchen Gemeinschaften wurde z.B. das Geschlecht eines Kindes nicht bei der Geburt festgelegt, sondern während des Aufwachsens. Oder die geschlechtliche Rolle konnte im Lauf des Lebens gewechselt werden.
Einige Communites jenseits der Zwei-Geschlechtlichkeit nutzen heute noch traditionelle Selbstbezeichnungen, z.B. die Hijra-Gemeinschaften in Pakistan, Indien und Bangladesch. Andere Selbstbezeichnungen, z.B. die der Indigenen Two-Spirit-Bewegung Amerikas sind im Anschluss an Traditionen erst in jüngerer Zeit entstanden. Bei diesen Selbstbezeichnungen handelt es sich i.d.R. nicht nur um Beschreibungen einer individuellen Identität, sondern um die einer Community bzw. einer bestimmten gesellschaftlichen Funktion. Ein respektvoller Umgang heißt in diesem Fall auch, die Begriffe nur dann für sich zu nutzen, wenn eine Person dieser Community angehört.
Ressourcen zur Begriffsklärung
Infomaterial
[Neu, zusammengefasst:
Im Internet gibt’s viele Infos zu TIN Themen, aber nicht alles ist vertrauenswürdig. Wir wollen hier einen Blick auf die verschiedenen Erfahrungen von trans*, inter* und nicht-binären Menschen werfen – vor allem aus ihrer eigenen Perspektive oder der ihrer Angehörigen. Dabei ist uns bewusst, dass die Liste der Ressourcen nicht vollständig ist]
Im Internet finden sich sehr viele Quellen zu trans und nicht-binären Themen. Nicht alle sind seriös, manches auch bewusst angelegt, um Angst und Vorurteile zu schüren. Wir wollen hier einen Einblick geben in die Lebenswelten von trans, inter und nicht-binären Menschen aus ihrer eigenen Perspektive oder die ihrer Angehörigen.
Erfahrungen sind innerhalb der trans und nicht-binären Communities sehr unterschiedlich – eine Erfahrung, die verschiedene trans oder nicht-binäre Personen verbindet, muss nicht von allen geteilt werden.
Gerade bei Mehrfach-Marginalisierung gehen die Erfahrungen oft sehr auseinander. So machen weiße trans Männer nach medizinischer Transition oft weniger Erfahrung von Diskriminierung, während trans Frauen, nicht-binären Menschen und trans Männern of colour häufig einen Umgang mit neuen Diskrimierungsformen finden müssen.
Auch die Erfahrungen von trans und nicht-binären Personen, die behindert werden oder chronisch krank sind, unterscheiden sich häufig deutlich von denen, die dies nicht erleben. Andere Faktoren sehr unterschiedlichen Erlebens können z.B. Alter, sexuelle Orientierung, Wohnort, Beruf, finanziellen Umstände, Elternschaft, religiöse Erfahrungen, Staatsbürgerschaft und vieles mehr sein. Wir haben uns bemüht, Quellen zusammen zu stellen, wo möglichst vielfältige Erfahrungen zu Wort – und bestenfalls in Dialog – kommen. Vielleicht findet ihr dabei einige Stimmen, die ihr mit euren eigenen Erfahrungen zusammenbringen könnt, oder entdeckt ganz neue Perspektiven. Die Erfahrungen der Community sind vielfältig und wir können viel voneinander lernen.
Wenn ihr Perspektiven ergänzen wollt, meldet euch gerne bei uns!
Ressourcen zum Start: [mit Disclaimer: viele der folgenden Links führen auf externe Webseiten, für deren Inhalte wir keine Haftung übernehmen können]
Infomaterialien von TrIQ (deutsche und englische Schriftsprache)
Radiosendung/ Podcast „Transgender Radio“ (vorwiegend deutsche Lautsprache)
Film „Bestimmt nicht“ (Deutsch, Englisch, DGS)
Frau. Mann. Und noch viel mehr. (Deutsch, Leichte Sprache)
Fotos + Interviews mit internationalen trans Frauen (Englische Schriftsprache)
Künstlerische Texte von jungen trans* Künstler_innen vom Projekt Trans* – Ja Und?! (Deutsch)
(Web)Comics: Ach, so ist das! (Deutsch)
Video: Generationenbegegnung ältere trans Frau und junges trans Mädchen (Englische Lautsprache + englische Untertitel)
Trans*lations. Texte und Gedichte von trans* Menschen. (Deutsche Schriftsprache)
Schweizer Website zum Thema Nicht-Binärität (Deutsche Schriftsprache)
#MyIntersexStory – Perspektiven von inter* Personen in Europa (Englische Schriftsprache)
Broschüre: Soll Geschlecht jetzt abgeschafft werden? – 12 Antworten auf Fragen zum Thema Selbstbestimmungsgesetz und Trans*geschlechtlichkeit (Deutsche Schriftsprache)
Film: A Year in Transition (Englisch + englische/französiche Untertitel)
Bin ich trans*, inter*, nicht-binär?
Wie finde ich das raus?
Die Findung der eigenen Identität ist für viele Menschen ein lebenslanger Prozess. Vieles kann sich im Laufe des Lebens immer wieder ändern, wenn wir neue Erfahrungen machen, oder neue Bedürfnisse in den Vordergrund treten. Andere Indentitätsanteile begleiten uns ein Leben lang.
Für viele Menschen wechseln sich dabei Phasen von Annäherung und Sicherheit mit Phasen von Verunsicherung und Neu-Überdenken ab, wie bei vielen anderen Lern- und identitären Prozessen auch. Viele queere Menschen haben verschiedene Identitäten (z.B. lesbisch, asexuell, queer, nicht-binbär, femme …) in ihrem Leben ausprobiert oder sie stehen nebeneinander. Wenn ein neuer Aspekt der Identität in den Vordergrund tritt, heißt das nicht, dass die anderen, bisher gelebten Aspekte damit getrennt werden. Sie dürfen – wenn gewollt – weiterhin ein wichtiger Teil unserer gelebten Biografie bleiben.
Wir verstehen trans*, inter* und/oder nicht-binär sein nicht als Endstationen eines indentitären Prozesses, sondern als Aspekte einer lebendigen Identität. Diese Bausteine unserer Identität können sich mit unserem Wachsen weiterhin verändern. Oder in sich selbst reifen, wenn wir z.B. immer neue Aspekte unserer Nicht-Binarität oder (trans) Weiblichkeit entdecken.
So kann es sein, dass trans* Männer nach einer medizinischen Transition neue feminine Ausdrucksweisen für sich entdecken, weil sie diese jetzt als einen Teil ihrer schwulen Identität verstehen können. Oder eine nicht-binäre Person entdeckt im Alter ganz neue Aspekte ihrer Identität, wenn sie in die Rolle eines Großelternteils hineinwächst.
Mögliche Vorgehensweisen und Tipps für einen Identitätsfindungsprozess
1) Nimm dir Zeit für deinen eigenen Prozess
Der identitäre Prozess jeder Person kann unterschiedlich aussehen. Ebenso ist unterschiedlich, welche Bedürfnisse TIN bzgl. ihrer Identität an ihr Umfeld haben und ob und falls ja, welche körperlichen Veränderungen sie möchten.
Häufig ist es für Menschen in unserer Beratung recht leicht zu sagen, was sich bisher nicht gut angefühlt hat und von welchen gechlechtlichen Erfahrungen sie gerne weg möchten. Es fällt aber vielen schwer, herauszufinden, wo es hingehen soll. Das ist kein Wunder: Während die Erfahrungen, die sich als nicht passend erwiesen haben, oft schon sehr lange gemacht wurden, wurden die Erfahrungen, die sich als passender erweisen können, oft noch nicht gemacht. Die meisten Menschen können nicht mit Sicherheit wissen, wie sich eine Situation anfühlt, in der wir noch nicht sind. Das erfordert ein langsames Heraustasten und Ausprobieren.
Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Oft gibt es verschiedenen Positionen aus dem Umfeld oder eigener Verinnerlichung, die Druck aufbauen: Sich nicht zu verändern, auf eine bestimmte Art und Weise das TIN Sein gestalten zu müssen, sich beweisen zu müssen … Das kann viel Kapazität kosten.
Nimm dir immer wieder Zeit, Dinge zu tun, die dir gut tun und such dir Raum für dich alleine und Gespräche mit anderen, um in deinem Tempo herauszufinden, was du brauchst. Falls du in deinem Umfeld bisher keinen Raum hast, über deine Gefühle zu sprechen oder dich auszuprobieren, kannst du dich z.B. an Gruppen aus der Community oder Beratungsstellen wenden, auch Therapie kann in vielen Fällen einen guten Raum bieten.
Es gibt mehr als einen richtigen Zeitpunkt für identitäre Prozesse und evtl. Transition. Es muss nicht die „eine einzig richtige“ Identität gefunden werden, sondern Bedürfnisse und Erfahrungen verändern uns unser Leben lang. Viele Veränderungen, z.B. das Nutzen eines neuen Namens oder ein neuer Kleidungsstil, können als Raum zum Ausprobieren geben, was sich für dich richtig anfühlt.
2) Wissen sammeln
Ohne ausreichendes Wissen über die eigene Situation und mögliche Optionen ist es i.d.R. schwer, eine gute Entscheidung zu treffen. Dies kann in Bezug auf geschlechtliche Identitätsfindung z.B. Wissen über Geschlecht und Körper umfassen, TIN Perspektiven und Community Erfahrungen, sowie Wissen um mögliche Veränderungs-Optionen.
Beispiel „Wissen über Körper“
Wissen über Körper kann helfen, den eigenen Körper neu zu erleben oder neue Gedankenwege zu eröffnen. Solches Wissen kann z.B. sein, dass…
- die meisten Körper sowohl Östrogen als auch Testosteron produzieren
- Klitoris und Penis in vieler Hinsicht ähnlich aufgebaut sind und ähnliche Funktionen erfüllen
- körperliches Geschlecht ein Spektrum ist
- viel Wissen um binäre Unterschiede auch durch Forschung bedingt ist, die auf den Vergleich von 2 Kategorien von Geschlecht ausgerichtet ist – würden andere Kategorien abgefragt, wäre auch anderes Wissen vorhanden
- viele Faktoren, in denen sich die Körperfunktionen von endo-cis Männern und Frauen unterscheiden, z.B. unterschiedlich aussehender Herzinfarkt, Haarausfall, Fähigkeit zu Stillen, Schweißproduktion, Muskelaufbau usw. weniger chromosomal als (epigenetisch) hormonell bedingt sind, d.h. fast jeder Körper bringt „Baupläne“ für unterschiedliche Funktionsweisen
- mit viele körperliche Unterschiede auch soziale Faktoren haben, z.B. unterschiedliche geschlechtliche Normen für Sport, Arbeit oder Ernährung
Innerhalb von TIN Communities wird auch die Neu-Benennung von eigenen körperlichen Prozessen (z.B. „Manstruation“) oder Bereichen des Körpers als Strategie angewandt, um die eigenen Erfahrungen zu beschreiben. Dabei entwickeln sich viele freud- und phantasievolle Wortneuschöpfungen und Neudeutungen des Körper. Im Bereich trans und BDSM/Sexualität forschen dazu u.a. Robin Bauer und Jonas Hamm.
3) Große Fragen unterteilen
Anstelle der großen Frage nach geschlechtlicher Identität kann es oft hilfreich sein, diese in verschiedene kleine Fragen aufzusplittern:
- Mit welchem Namen und welcher Anrede möchte ich gerne angesprochen werden?
- Welches Pronomen fühlt sich passend an, wenn Leute über mich reden?
- Wie fühle ich mich mit meinem Körper? Gibt es Bereiche meines Körpers, mit denen ich mich nicht wohlfühle? Kann ich mir etwas vorstellen, was mir helfen könnten, mich wohler zu fühlen?
- Wie würde ich mich gerne kleiden, mich ausdrücken oder zeigen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte?
- Werde ich von anderen geschlechtlich anders wahrgenommen, als ich mich wahrnehme oder wahrgenommen werden will?
- Gibt es etwas, was mich im Alltag oder in meinen Beziehungen besonders belastet? Was würde ich gerne mit diesen Kapazitäten machen, wenn ich davon entlastet werden würde?
4) Erwartungen von außen und eigenen Wünschen
Häufig gibt es den Tipp, zu versuchen, die eigenen Wünsche von Erwartungen von außen zu trennen. Das ist eine komplexe Angelegenheit: Auf der einen Seite ist beides häufig nicht identisch und eigene Wünsche stehen mit Erwartungen der Umwelt in Konflikt. Auf der anderen Seit gibt es aber auch manchmal Druck, sich „völlig autark“ von der Sozialen Umgebung entscheiden zu müssen, weil nur dies autentisch wäre – was auch den Eindruck eines Coming Outs als sozialen Trennungsprozess verstärkt.
Dabei ist Identität immer auch sozial bestimmt und eine Anerkennung durch das Umfeld ist für viele Menschen ein wichtiges Grundbedürfnis. Während die Frage „wer wäre ich gerne, wenn ich alleine leben würde“ für manche also eine hilfreiche sein kann, ist auch die Frage „wer möchte ich gerne mit anderen sein/ was möchte ich den Menschen in meinem Umfeld von mir zeigen“, mindestens ebenso bedeutsam. Die Begriffsspektrum von „Comingout“ zu „Letting In“ (siehe entsprechender Abschnitt) zeigt dieses Spannungsfeld: Oft geht es bei der Identitätsfindung ebenso darum, sich von sozialen Vorstellungen und Erwartungen zu lösen, wie sich auch anderen verstärkt zuzuwenden und Verletzlichkeit und Vertrauen zuzulassen.
Faktoren, die mehr Sicherheit geben:
– Konstanz von Erfahrungen und Wünschen
– Sichere(re) Umgebung schaffen
– Räume finden, um Veränderungen auszuprobieren
– Orientierung an „Was fühlt sich gut an? Wie würde ich gerne leben?“
Gesellschaftliche Erwartungen oder Identität?
[Ein Satz dazu, warum hier und an bestimmten anderen Stellen I* nicht mitverhandelt wird – mit dem I*Team besprechen!]
Ich fühle mich mit den Erwartungen, die unsere Gesellschaft an Frauen und Männer stellt, nicht wohl – bin ich deswegen vielleicht trans* oder nicht-binär?
Diese Frage kann eine große Herausforderung für diejenigen sein, die sich mit der Ihnen zugeschriebenen Rolle in besonders vielen Aspekten nicht wohlfühlen. Diese Auseinandersetzung muss nicht bedeuten, dass eine Person sich (später) als trans* oder nicht-binär verstehen wird, sondern ist ein wichtiger identitärer Auseinandersetzungsprozess für die meisten Menschen in unserer Gesellschaft.
Cis Männer, die bestimmt Formen von Männlichkeitszuschreibung für sich selbst ablehnen, z.B. offen ihre Verletzlichkeit ausdrücken, gerne Kleider tragen, sich in Männer verlieben oder gerne Fürsorge-Arbeit übernehmen, sind deswegen nicht weniger Männer.
Cis Frauen, die bestimmte Formen von Weiblichkeitszuschreibungen für sich selbst ablehnen, z.B. Kraftsport lieben, gerne Anzüge tragen, sich nicht rasieren, oder als Bauleiterinnen arbeiten, sind deswegen nicht weniger Frauen.
Auch binäre trans Personen, die sich als Männer oder Frauen verstehen, streben i.d.R., eine bestimmte geschlechtliche Rolle zu erfüllen, sondern ihre jeweils eigene Männlichkeit oder Weiblichkeit ausdrücken und zeigen zu können.
Innerhalb von einiger queeren Szenen ist auch der Gebrauch von geschlechtlich anders konnontierten Namen oder Pronomen üblich, ohne dass das im Gegensatz zu einer cis weiblichen oder männlichen Identität stehen muss. Das gilt z.B. zeitweise für Dragkings und -Queens. Aber auch gerade unter älteren schwulen Männern ist es nicht unüblich, über sich gegenseitig als „sie“, und z.T. auch mit weiblichem Namen zu sprechen. Und in Butch Szenen gibt es z.T. ähnliches mit „er“ Pronomen und männlicher Form des Namens, ohne dass das jeweils die Identität als Mann oder Frau in Frage stellen muss.
Diese Szenesprache ist historisch auch aus Gründen des Schutzes entstanden, um Identität oder Orientierung nicht an außenstehende preiszugeben, aber intern erkannt zu werden. Heute kann es einerseits ein Spiel mit geschlechtlichen Zuordnungen bedeuten, als auch die Herausbildung von Identitäten, die weder cis noch trans, noch unbedingt nicht-binär sind, sondern spezifisch lesbisch oder schwul. Dies schließt z.T. an an Diskurse der 70er/80er Jahre an, z.B. Moniques Wittigs „Lesben sind keine Frauen“ und Diskurse der Tuntenbewegung.
Geschlechtsidentität und geschlechtliche Rolle sind nicht unabhängig voneinander, aber auch (zumindest im binären Geschlechtersystem) auch nicht gleichbedeutend. Hier findet sich eine Grafik, die das verdeutlichen soll – es ist aber wichtig, zu beachten, dass es im individuellen Fall komplexere Überschneidungen geben kann.
Letztendlich ist ein persönlicher Prozess, den eigenen Weg zwischen Umgang mit Rollenzuschreibungen und geschlechtlicher Identität zu finden. Und Verantwortung der queeren und feministischen Communities, alle verschiedenen Wege wertzuschätzen und anzuerkennen.
Kann ich auch trans* oder nicht-binär sein, wenn … ?
Häufig kommen Menschen in unsere Beratung, die unsicher sind, ob sie auch trans und_oder nicht-binär sein können, weil sie nicht einer bestimmten geschlechtlichen Erwartung entsprechen.
Trans* Männer und trans* Frauen sind ebenso individuell in ihrem Geschlechts-Ausdruck, ihren Vorlieben und Erfahrungen wie cis Männer und cis Frauen. Nicht-binäre Menschen können ebenso verschieden aussehen, sich verhalten und Vorlieben haben, wie alle anderen Menschen.
Trans* Menschen sind nicht verpflichtet, ein Klischee von Männlichkeit oder Weiblichkeit zu verkörpern. Wenn du viele der gesellschaftlichen Vorstellungen von Männlichkeit oder Weiblichkeit für dich selbst zutreffend findest, ist das ebenso valide.
Nicht-binäre Menschen sind nicht verpflichtet, androgyn auszusehen oder sich auf Ausdrucks- und Handlungsweisen zu beschränken die gesellschaftlich als „geschlechtsneutral“ gelten. Wenn dies jedoch für dich passend ist, ist das ebenso valide.
- Du kannst auch trans männlich sein, wenn du Dinge an dir schätzt, oder gerne machst, die du und/oder andere als feminin wahrnehmen, z.B. gerne Kleider oder Makeup trägst, deine Brüste magst, Beziehungen mit Männern bevorzugst, sensibel und fürsorglich bist, gerne Handarbeit machst, …
- Du kannst auch trans weiblich sein, wenn du Dinge an dir schätzt oder gerne machst, die du und/oder andere als maskulin wahrnehmen, z.B. gerne Anzüge oder Hemden trägst, deine Körperhaare schätzt, Beziehungen mit Frauen bevorzugst, dir gerne Raum nimmst, gerne handwerkst, …
- Du kannst auch nicht-binär sein, wenn viele deiner Eigenschaften und Vorlieben gesellschaftlich als „weiblich“ oder „männlich“ wahrgenommen werden oder du sie selbst so wahrnimmst.
Auch die Kindheits- und Jugenderfahrungen von Menschen sind sehr unterschiedlich.
Manche trans Männer sprechen davon, dass sie „weiblich sozialisiert“ wurden. Damit kann z.B. gemeint sein, dass:
- bestimmte Erfahrungen gemacht wurden
- bestimmte Erfahrungen nicht gemacht werden konnten
- bestimmte Eigenschaften von ihnen erwartet wurden
- sie insgesamt sozial als Mädchen oder weibliche Jugendliche wahrgenommen wurden
Für andere passt diese Beschreibung überhaupt nicht oder sie haben ganz andere Erfahrungen gemacht.
Kindheits- und Jugenderfahrungen auch von trans und nicht-binären Menschen sind individuell. Für manche ist ihre Geschlechtsidentität ein unveränderlicher Faktor seit frühester Kindheit. Für andere ist es ein langer Prozess, bei dem erst Wissen über mögliche Lebensmodelle und Erfahrungsaustausch benötigt wird. Bei anderen hingegen verändert sich die Identität im Laufe des Lebens immer wieder.
Was, wenn meine Wünsche sich später ändern?
Detransition/ Retransition:
Die Begriffe De- und Retransition werden ganz unterschiedlich definiert und manchmal auch synonym gebraucht. Gemeint ist immer eine Neu-Ausrichtung in der Transition, z.B. wenn eine Person aufhört, Hormone zu nehmen, oder nach einer Östrogen-Therapie lieber mit Testosteron weitermachen möchte. Häufig ist das Ziel einer De- oder Retransition, bestimmte medizinische oder soziale Transitions-Schritte (so weit möglich) rückgängig zu machen.
Viele Gründe für eine Veränderung
Manche Menschen merken nach einiger Zeit, dass sie de- oder re-transitionieren möchten. (Die beiden Begriffe sind unten näher erklärt.) Es kann dabei viele Gründe für eine Beendigung oder Unterbrechung der Transition geben:
- Es geht dir emotional nicht gut mit den Veränderungen, es fühlt sich nicht richtig an.
- Du leidest unter (starken) Nebenwirkungen.
- Es treten keine Veränderungen ein.
- Der soziale Druck gegen die Transition ist hoch und du hast nicht die Kapazitäten, diese gerade weiter fortzuführen.
- Du möchtest ein Kind zeugen oder gebären.
- Du merkst, dass dir die bisherigen Veränderungen reichen und du keine weiteren möchtest.
- Du lernst neue Sachen über deine Geschlechts-Identität oder diese verändert sich, z.B. in Richtung deines zugeordneten Geschlechts, keines Geschlechts oder eines nicht-binären Geschlechts.
- Du brauchst eine Pause, um die bisherigen Veränderungen einordnen zu können oder weil du gerade keine weiteren Umbrüche möchtest.
- …
Es ist jederzeit in Ordnung, deine Transition zu beenden oder neu auszurichten. Du darfst über deinen Körper selbst bestimmen – das Wichtigste ist, dass es dir mit den Veränderungen gut geht und du dich wohlfühlst.
Niemand hat das Recht, dir vorzuschreiben, ob, wie lange oder in welcher Form du transitionierst. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig für den Abbruch oder die Neu-Ausrichtung deiner Transition.
Ob du transitionierst oder nicht, entscheidet nicht über deine Geschlechtsidentität. Du kannst vor, in und nach der Transition stets selbst darüber bestimmen, wie du dich geschlechtlich verortest.
Es ist in Ordnung, sich als trans* oder nicht-binär zu verorten und nicht medizinisch und_oder sozial zu transitionieren. Es ist auch in Ordnung, medizinische Behandlungen gemacht zu haben und sich wieder dem sozialen Geschlecht vor der Transition zugehörig zu fühlen – egal ob du körperlich detransitionierst oder nicht.
Ärzt_innen können dich dazu beraten, ob es für deine (Detransitions-)Ziele sinnvoll sein kann, die Dosis deiner Medikamente anzupassen oder die Hormontherapie für eine bestimmt oder unbestimmte Zeit zu unterbrechen. Je nachdem, ob du hormon-produzierende Organe besitzt (oder nicht) und ob diese aktiv sind, sind unterschiedliche Dinge bei der Beendigung der Hormontherapie zu beachten.
Auch Beratungsstellen der Community können dich bei einer Re- oder De-Transition unterstützen.
Auch de-transitionierende Menschen können zur trans* und nicht-binären Community gehören. Manchmal erfahren Menschen nach ihrer De-Transition (weiterhin) trans–und nicht-binär-Feindlichkeit, weil sie nicht (mehr) als cis gelesen werden. Manche Erfahrungen von Re- und De-Transitionier_innen werden auch für trans- und nicht-binär-feindliche Äußerungen genutzt.
Es ist gerade deshalb wichtig, sich nicht spalten zu lassen und miteinander solidarisch zu sein. Es gibt viele geteilte Erfahrungen und gemeinsame Interessen bzgl. einer druck-freien, gut informierenden und zugänglichen Gesundheits-Versorgung und einer Offenheit für Umbrüche in der geschlechtlichen Verortung.
Detransition/ Retransition:
Die Begriffe De- und Retransition werden ganz unterschiedlich definiert und manchmal auch synonym gebraucht. Gemeint ist immer eine Neu-Ausrichtung in der Transition, z.B. wenn eine Person aufhört, Hormone zu nehmen, oder nach einer Östrogen-Therapie lieber mit Testosteron weitermachen möchte. Häufig ist das Ziel einer De- oder Retransition, bestimmte medizinische oder soziale Transitions-Schritte (so weit möglich) rückgängig zu machen.
Ressourcen zum Thema Detransition
Artikel: Detransition, Fakten und Studien, 28.09.2022 von Jenny Wilken
Blog: „shes in detransition“ von Eli Kappo
Broschüre: „Erfahrungsberichte Detransition“ des queeren Netzwerk Niedersachsen
Kontakt und Coming Out
Wo finde ich andere TIN Personen?
Austausch mit anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen, kann eine der größten Ressourcen bei Lebensveränderungen und Prozessen der Identitätsfindung sein.
Dieser Austausch kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise stattfinden: Als klassische Selbsthilfe-Gruppe, als Freizeit-Gruppe, z.B. Sportgruppe, Lesezirkel oder Kreativ-Gruppe, als gemeinsam entspannt bei einem Getränk verbrachter Abend oder Online Gruppe zu einem bestimmten Thema… Mittlerweile ist das Angebot sehr umfangreich und umfasst viele Bedürfnisse.
Hier findest du eine Übersicht über soziale Vernetzungen, die in Berlin, online oder überregional stattfinden:
Angebote Gruppen und Austausch
Für Berlin kann auch ein Blick in die Kleinanzeigen der Siegessäule hilfreich sein, wo häufig neue Gruppenangebote beworben werden.
Menschen, die nicht in Berlin leben, können auch ihre regionalen Beratungsstellen nach Tipps fragen.
Wenn ihr gerne ein eigenes Angebot starten möchtet, könnt z.B. ihr TrIQ oder eine andere queere Organisation anschreiben – viele Organisationen stellen ihre Räume gerne für Gruppen zu Verfügung und sind ansprechbar für Planungsprozesse.
Kontakt zu TrIQ: triq@transinterqueer.org
Coming Out im privaten Umfeld
In einer Gesellschaft, in der Geschlecht eine der zentralen Kategorien von Identität ist, bedeutet die Nachricht, dass eine Person ein anderes Geschlecht hat, als bisher gedacht, oft eine große Veränderung für Partner_innen, enge Freund_innen und Familie.
Die Nachricht stellt häufig die bisherige Beziehungsdynamik in Frage, d.h. Menschen müssen sich nochmal neu oder auf einer anderen Ebene kennenlernen. Das ist für viele Menschen herausfordernd gerade, wenn vertraute Muster (scheinbar) wegbrechen. Dies gilt häufig verstärkt, wenn Beziehungen lange andauernd und auf vielen Ebenen konstant waren, in der Beziehung also noch nicht viel Erfahrung im Umgang mit Veränderungen vorhanden ist.
Im Kontrast oder Ergänzung zum Konzept des „Coming Out“ (übersetzt: Herauskommens), wird im englischsprachigen Raum in den letzten Jahren verstärkt das Konzept des „Letting In“ (übersetzt: Hineinlassens) sichtbar.
„The „letting in“ frame allows for agency over what to disclose, to whom and when. If coming out is a confession, then letting in is a communion. We share our life stories, not just our secrets.“
Espinoza, 2016
Übersetzung: „Der Rahmen des „Hereinlassens“ ermöglicht es, selbst zu entscheiden, was, wem und wann man etwas preisgibt. Wenn das Coming Out ein Bekenntnis ist, dann ist das Einlassen (eine Handlung der) Verbundenheit. Wir teilen unsere Lebensgeschichten, nicht nur unsere Geheimnisse.“
Das Konzept des „Letting In“ macht Ziele des Mitteilens auf Beziehungsebene sichtbarer: Es geht darum, einen Teil von sich zu zeigen, ‚gesehen werden‘ zu ermöglichen, Vertrauen zu stärken und die Beziehung gemeinsam neu zu gestalten, aber auch an bisherige Vertrautheit anzuknüpfen. Für viele ist ein soziales Gesehen-Werden in ihrer Identität die Grundlage für einen entspannteren Alltag.
Die Reaktionen auf ein Coming Out/ Letting In können sehr unterschiedlich sein. Oft werden auch gemischte Gefühle im Gegenüber hervorgerufen. Die Veränderung der Beziehung kann für Menschen herausfordernd sein, für einige auch bedrohlich, andere sind vielleicht erleichtert, weil sie gemerkt haben, dass dich etwas bedrückt sich über dein Vertrauen freuen.
Ein Coming Out/ Letting In muss und kann nicht perfekt sein. Die Situationsverantwortung liegt immer bei allen Beteiligten, nicht nur der sich mitteilenden Person – ein Gespräch kann noch so sorgfältig vorbereitet sein und trotzdem kommt nicht die erwünschte Verständigung dabei raus. Oder es verläuft spontan und ist trotzdem genau richtig so.
Im Folgenden findet ihr einige Tipps, wie gute Umstände für ein Coming Out/ Letting In geschaffen werden können, bzw. welche Ebenen bedacht werden können:
- Thema austesten/ Reaktionen einschätzen können
Suche das Gespräch über TIN oder angrenzende Themen (Queerness, Diversität, Veränderungen in Beziehungen …), um Wissen zu sammlen, wie die Person auf diese reagiert. Frag vertraute Personen: „Was denkst du, was verbindet die Person mit dem Thema?“ Emotionale Ebene: Schau dir an, wie die Person bisher auf Veränderungen in Beziehungen reagiert hat. Sind Gespräche über Emotionen oder verletzliche Themen bisher gut gelaufen? Wenn ja, was hat zum Gelingen des Gesprächs beigetragen? - Sicherheit geht vor
Bestehen Abängigkeiten von der Person (finanziell, emotional, Pflege …)? Falls ja, überlege, wie du dich gut absichern kannst. Falls du z.B. noch bei den Eltern wohnst, gibt es eine Alternative, wo du eine Zeit lang unterkommen kannst? Falls es die Vermutung gibt, dass es zu Gewalt kommen kann, überleg dir, wie du dich schützen kannst und ob es Alternativen, z.B. einen späteren Zeitpunkt, gibt – Sicherheit geht immer vor! Dasselbe gilt, falls du Sorge hast, dass eine verletzende Reaktion deine psychische Stabilität gefährden könnte. - Tausch dich mit anderen aus
Frage Menschen, die bereits Erfahrung mit Coming Out /Letting In haben, nach ihrem Wissen: „Wie hast du das gemacht? Hast du vielleicht einen Tipp für mich?“ Du bist nicht alleine mit den Herausforderungen, die die Planung eines Coming Out/ Letting In bedeutet, sondern kannst auf viel Wissen in queeren Communites zum Thema schöpfen. Wenn du bisher keine persönlichen Kontakte hast, wirf einen Blick in unsere Ressourcen zum Thema Gruppen, oder wende dich an eine Beratungsstelle. - Ängste und Sorgen des Gegenübers beachten
Überleg dir: „Welche Ängste oder Sorgen kommen vielleicht beim Gegenüber auf? Wie kann ich mich vielleicht schon darauf vorbereiten, um der Person etwas an die Hand zu geben?“ Soziale Ängste sind häufig Thema: Verurteilung oder Ausschluss aus einer Gemeinschaft, Versagen als Elternteil/Partner_in, Sorge vor einer prekären Zukunft… Bei langjährigen Beziehungen haben Menschen häufig Zukunfts-Vorstellungen, die durch Veränderung in Frage gestellt werden oder anders in Wirkung treten werden. Oft muss eine neue Vertrautheit miteinander erwoben werden. Manchmal muss auch die Basis der Beziehung neu geklärt werden, dies gilt gerade für romatische und_oder sexuelle Partnerschaften. Falls das Coming Out gegenüber einer Person erfolgt, die abhängig von dir ist, z.B. Kinder, pflegebedürftige Angehörige, kann die Veränderung auch bedrohlich wirken: „Wird mein Elternteil noch genauso da sein für mich?“ Häufig ist es hilfreich, die möglichen Ängste des Gegenübers zu adressieren, zu beruhigen oder einen gemeinsamen Prozess dazu anzuregen. ‚ - Ziel des Gesprächs formulieren
Überleg dir: „Was will ich sagen, was ist mein Ziel bei dem Gespräch? Will ich Ängste benennen, Prozessbegleitung oder einen bereits abgeschlossenen Prozess mitteilen? Suche ich Unterstützung oder will vor allem gesehen werden? Wie realistisch ist mein Ziel?“ Häufig ist es hilfreich, Ziele vorher aufzuschreiben, um sich klarer darüber zu werden, welche Themen beim ersten Gespräch mitgeteilt werden sollen und welche Themen noch Zeit haben. - Zeitpunkt und Ort auswählen
Es ist meistens hilfreich, eine Situation und einen Ort auszuwählen, der für alle Beteiligten möglichst entspannt ist. Das kann ein vertrauter Ort, sein, um an Vertrautes in der Beziehung anzuknüpfen und zu zeigen, dass vieles bleibt. Oder ein neuer positiver Ort, um gemeinsame Veränderungen und Entdeckungen zu betonen. Es ist sinnvoll, einen Ort zu wählen, von dem alle Beteiligten selbstständig wieder gut wegkommen und an dem sie, falls gewünscht, alleine sein können oder eine vertraute Person aufsuchen können. Ungünstig ist das Comingout i.d.R. im Streit oder in stressigen Situationen – manchmal sind es aber auch gerade diese Situationen, wo es „herausbricht“, weil der Streit vielleicht auch etwas mit „sich nicht zeigen können“ zu tun hat. Oder weil gerade so viel im Umbruch ist, dass Umbrüche in einem selbst mit berührt werden. - Mitteilungsform wählen
Es gibt viele mögliche Mitteilungsformen für ein Coming Out/ Letting In: Schriftlich per Brief, persönliches Gespräch, Zoomcall, Telefonat oder Vermittlung durch eine vertraute Person … Überleg dir: Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Mitteilungsformen? Welche Gesprächssituation ist entspannt für dich? Welche ist entspannt für die andere Person? Im besten Fall ist die Mitteilungsform für beide Beteiligten gut zugänglich. - Evtl. Unterstützung mitnehmen
Überleg dir: „Wer soll dabei sein? Gibt es eine Person, die dich und/oder dein Gegenüber emotional entlasten kann?“ Manchmal ist es hilfreich, eine Person mitzunehmen, die das Gespräch begleiten kann. Das kann z.B. eine Freundin sein, die an deiner Seite ist, damit du dich sicherer fühlst. Oder ein Freund deines Gegenübers, der ihm_ihr Unterstützung geben kann. Auch eine Sozialarbeiter_in oder Therapeut_in, kann dir vielleicht helfen, deinen Angehörigen die Situation verständlicher zu machen. Oder eine erfahrene Person aus einer Selbsthilfe-Gruppe. - Zugänge zum Thema schaffen
Überleg dir: „Welchen Zugang hat mein Gegenüber bisher zu dem Thema TIN? Welche Themen sind wichtig im Leben des Gegenübers?“ Vielleicht findest du dadurch etwas, wie du deinem Gegenüber einen guten Zugang zu deiner Mitteilung ermöglichen kannst. Ist z.B. Religion ein wichtiger Teil des Lebens deines Gegenübers, kann es hilfreich sein, sich eine unterstützende Person aus der Gemeinde zu suchen oder Broschüren mitzubringen, die sich aus dieser Perspektive positiv auf TIN beziehen. Ebenso hilfreich können wissenschaftliche Quellen und Studien, Anknüpfung an Lebensumbrüche des Gegenübers, erklärende Websiten in zugänglicher Sprache o.ä. sein. Auch Angehörige brauchen häufig Support aus einer Gemeinschaft, um Umbrüche gut gestalten zu können. Das können Unterstützer_innen aus Communities sein, in denen sie sich bisher bewegen. Oder neue Communities, z.B. Gruppen für Partner_innen oder Eltern von TIN. Beratungsstellen sind ebenfalls ansprechbar für die Bedarfe von Angehörigen und vermitteln Zugang zum Thema. - Vor- und Nachbereitung für dich
Überleg dir: „Welche Vor- und Nachbereitung brauche ich?“ Es kann zum Beispiel die Situation entspannen, wenn du vorher einen Spaziergang oder etwas Schönes mit vertrauten Menschen machst. Oder dir vor oder nach dem Gespräch eine Auszeit nimmst. Es ist immer gut, einen Plan zu haben, wo man hingehen kann, wenn das Gespräch nicht gut verläuft, um Entlastung zu finden. Also z.B. einen Abend mit einer Freundin nach dem Gespräch zu planen oder sich einen Wohlfühlort zu gestalten, an den man sich anschließend zurückziehen kann. - Was mache ich, wenn sich kein Dialog entwickelt?
Wenn das Gespräch konfliktreich läuft und es nicht zu einer Verständigung kommt, gibt es trotzdem einiges, was du jetzt für dich und die Beziehung tun kannst: Sorge für dich selbst und such dir Räume, Aktivitäten und Menschen, die dir gut tun. Lass dir und dem Gegenüber Zeit, das Gespräch zu verarbeiten. Oft ist es sinnvoll, erstmal Abstand zu gewinnen, um wieder zu Ruhe zu kommen. Manchmal ist es sinnvoll, später erneut das Gespräch zum Thema zu suchen. Manchmal ist es sinnvoll, sich (zunächst) auf neue Beziehungsziele oder Beziehungen zu anderen Menschen zu konzentrieren. Wenn du in einer Krise bist, findest du hier Anlaufstellen, die dich unterstützen, ebenso helfen auch Beratungsstellen beim Umgang mit konfliktreichen Situationen.
- Was mache ich, wenn ich gehört worden bin?
Erstmal: Feiere mit deinem Gegenüber eure Beziehung und das gemeinsame Vertrauen, vielleicht auch die kommenden Veränderungen. Macht etwas zusammen, was euch verbindet und gut tut, egal ob gemeinsam Kochen, einen Film sehen, verreisen, Computer spielen, Kaffee trinken … Überleg dir: „Wie viel will ich in Zukunft teilen, was will ich für mich selbst behalten?“ Vielleicht öffnet dein Vertrauen einen Raum auch für die andere Person, verletzliche Themen zu teilen und eure Beziehung kann wachsen. Es ist aber auch in Ordnung, wenn du gar nicht viel Veränderung möchtest, sondern es bei dem bisherigen Maß auch Nähe und Distanz bleiben sol
Weitere Ressourcen zum Thema Coming Out/ Let In
„Coming Out“ Broschüre des Queer-Lexikon (Deutsche Schriftsprache)
Coming Out Tipps der DGTI (Deutsche Schriftsprache)
Artikel zum Konzept „Letting In“:
Pugh, 2016: No More Queer Confessions: „Coming Out“ vs. „Letting In“ (Englische Schriftsprache)
Coming Out im Arbeitskontext
Ein Coming Out im Arbeitskontext hat i.d.R. andere Rahmensetzungen als im privaten Umfeld. Es ist i.d.R. weniger ein vertrautes Teilen im Sinne eines „Letting In“, sondern hat häufig den Rahmen einer sachlichen Mitteilung, um Grundvorraussetzungen eines guten Arbeitens anzumelden, also z.B. einen respektvollen Umgang mit Namen und Pronomen.
Dabei unterscheiden sich verschiedene Kontexte, z.B.:
- Start in einer neuen Organisation, wenn z.B. die offiziellen Dokumente einen anderen Namen zeigen als den im Alltag genutzten
- Bewerbung als nicht-binäre Person, die eine neutrale Anrede und Pronomen-Nutzung als gute Arbeitsgrundlage braucht
- Coming Out in einer Organisation, in der eine TIN Person schon länger tätig ist
- Gezielte Bewerbung als TIN Person, z.B. weil die Stelle für bestimmtes Community Fachwissen ausgelegt ist
Je stärker ihr Arbeitskontext mit ihrem Privatleben verknüpft ist, z.B. durch langjährige Freundschaften mit Kolleg_innen oder Familienbetriebe, desto mehr können sie sich auch an der Handreichung zu Coming Out im Privaten Umfeld orientieren.
Tipps für den Coming Out Prozess in Arbeitskontexten
Machen Sie sich eine Liste:
– Was möchte ich im Betrieb teilen?
– Was soll privat bleiben?
– Wer im Betrieb soll/muss worüber Kenntnis haben?
– Wer ist ansprechbar für Unterstützung?
– Wer ist zuständig für die Änderung von Unterlagen?
– Was brauche ich, um weiterhin gut arbeiten zu können?
Häufig ist es sinnvoll, das Coming Out im Arbeitskontext als sachlich zu formulieren und klar auszudrücken, welche Unterstützung Sie jetzt benötigen, um weiterhin gut arbeiten zu können.
Es kann auch hilfreich sein, dem Arbeitgeber und/oder Kolleg_innen eine der rund ums Thema „TIN und Arbeitsmarkt“ erschienen Broschüren an die Hand zu geben oder auf unseren FAQ Text für Arbeitgeber_innen und Kolleg_innen zu verweisen (siehe unten).
Weiterführende Ressourcen:
Broschüre „Trans am Arbeitsplatz“ (Deutsche Schriftsprache)
Broschüre „Trans in der Arbeitswelt“ (Deutsche Schriftsprache)
Broschüre „Trans Visible – Trans* und Arbeitsmarkt“ (Deutsche Schriftsprache)
Broschüre „Geschlechtliche Vielfalt im Öffentlichen Dienst“ (Deutsche Schriftsprache)
Tipps für Arbeitgeber*innen von der DGTI (Deutsche Schriftsprache)
Coming Out in der Schule
Material rund ums Coming Out in der Schule:
Artikel des englisch-sprachigen Berliner Magazins „Ex Berliner“ über trans Jugendliche im Berliner Schulsystem und Unterstützungsmöglichkeiten: „Coming out trans at school“ (Englische Schriftsprache)
Broschüre: „Akzeptrans* – Arbeitshilfe für den Umgang mit transsexuellen Schüler_innen“ (Deutsche Schriftsprache)
Broschüre: „Trans und Schule“ (Deutsche Schriftsprache)
Broschüre: „trans* Jugendliche begleiten und unterstützen“ (Deutsche Schriftsprache)
Broschüre: „Trans* ganz einfach“ (deutsche Schriftsprache)
In der folgenden Liste findet ihr viele Ressourcen rund um Beratung und Vernetzung von geschlechtskreativen Kindern, TIN Jugendlichen (und jungen Erwachsenen) und ihrer Angehörigen:
Informationen für TIN Jugendliche, geschlechtskreative Kinder, Eltern und andere Angehörige
Materialien für Lehrer_innen, Pädagog_innen und andere Fachkräfte im Sozialbereich:
Coming Out und Vernetzung im Studium
Anlaufstelle: Queer-Referate und Gleichstellungsbeauftragte
Sowohl für Studienanfänger_innen als auch Studis, die schon länger an der Hochschule sind, kann das Queer-Referat des AStAs eine gute Anlaufstelle sein, um sich zu vernetzen oder z.B. Infos über die Möglichkeiten zur Namensänderung an deiner Hochschule zu bekommen.
Manchmal heißen die Referate auch z.B. FLINTA-Referat, Schwulen*Referat, Lesben*Referat usw. Häufig können auch die Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten weiterhelfen, bei Diskriminierungsfragen entweder der AStA oder die entsprechenden Anlaufstellen deiner Hochschule. Im Waldschlösschen finden regelmäßig bundesweite Vernetzungtreffen queerer Hochschulreferate statt.
Die HU Berlin bietet eine Beratung extra für trans* Studierende an.
Namens- und Geschlechtseintragsänderung:
An vielen Hochschulen ist die Änderung des Namens und Geschlechtseintrags über den DGTI Ausweis möglich.
Veröffentlichung zum Thema gibt es von einigen Hochschulen, z.B. der TH Köln und der ASH Berlin, sowie auch von der Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes.
Akademische Vernetzungsgruppen:
1) Arbeitsgruppe Trans*emanzipatorische Hochschulpolitik
2) Monatliches Treffen für TIN Studierende der Berliner Hochschulen
zum T3) Petition der Gruppe „TIN* inklusive Uni jetzt“
Weiterführende Ressourcen:
Broschüre: „Inter* und Trans* an der Hochschule – Informationen zum kompetenten Umgang mit Inter*- und Trans*studierenden für Entscheidungsträger*innen an Hochschulen“ (Deutsche Schriftsprache)
Broschüre: „trans. inter*.nicht-binär. Lehr- und Lernräume an Hochschulen gestalten“
(Deutsche Schriftsprache)
Broschüre: „Trans Inter Nicht-binär in der Lehre“ (Deutsche Schriftsprache)
Infos für Partner_innen, Eltern und andere Angehörige
Unterstützung als bzw. für Partner_innen
Im Folgenden finden Sie Tipps zum Umgang mit einem Coming Out/ Letting In in einer bereits bestehenden Partnerschaft. Menschen, die eine neue Beziehung mit einer TIN Person eingehen möchten oder generelle Fragen zu Beziehungsthemen haben, können sich ebenso gerne an unsere Beratungsstelle wenden.
Ein Coming Out oder Letting In kann vieles für eine Beziehung bedeuten:
- eine große Herausforderung, weil sich vieles verändert
- in Frage gestellte Zukunftspläne und bisher angenommene Selbstverständlichkeiten
- verstärkte Intimität und Nähe, weil etwas Verletzliches anvertraut wurde
- einen bestärkten gemeinsamen Prozess hin zu dem, was beide Personen brauchen
- Probleme durch die Umwelt und_oder enttäuschte Erwartungen
- Erleichterung, weil die Ursache von Problemen, z.B. Rückzug, Depression, benannt wurde
- neue Identitätsprozesse bzgl. sexueller oder romantischer Identität auch für die Partner_in
- Konflikte, weil Bedürfnisse auseinander gehen
- neue Auslotung: Passt diese Beziehungsform noch für beide?
Die Situation jeder Beziehung ist unterschiedlich: Manche Partner_innen werden durch ein Coming Out/ Letting In überrascht, weil die Prozesse der anderen Person für sie nicht sichtbar waren oder bisher verborgen wurden. Das kann die Herausforderungen und das Konfliktpotential erhöhen, weil eine Person schon einen langen Prozess hatte und jetzt bereit ist für Veränderungen, die andere Person aber plötzlich mit anstehenden Veränderungen konfrontiert ist. Andere Partner_innen haben schon lange „etwas geahnt“ oder das Thema war von Anfang an in der Beziehung mit dabei. Manchmal ist das Letting In auch überraschend, wird aber trotzdem sehr erleichtert/positiv aufgenommen, weil es als Vertrauens-Zeichen und evtl. auch als Erklärung bestehender Beziehungs-Probleme gesehen wird.
Herausforderungen können erhöht werden durch:
- eine für die Partner_in plötzlich stattfindende Veränderung
- unterschiedlicher Wissenstand beider Partner_innen in Bezug auf queere Lebensrealitäten
- unterschiedliche Lebensphasen, z.B. Wunsch nach Stabilität vs. Wunsch nach Aufbruch
- in Fragestellung der sexuell/romantischen Orientierung, z.B. bei bisheriger klarer Ausrichtung auf ein Geschlecht, oder geschlechtsspezifische Dating-Typen
- Belastung und Stress durch die Umwelt, bzw. herausforderndes Coming Out im Arbeitsumfeld, der Nachbarschaft oder Verwandtschaft
- evtl. Umbruch weiterer Faktoren im Leben der Partner_in, die mit dem Coming Out einhergehen , z.B. neuer Berufswunsch, Wunsch nach Umzug
- Herausforderungen und Umbrüche im eigenen Leben, die nicht den nötigen Raum bekommen oder die Kapazitäten für weitere Veränderungen senken
- Vertrauensverlust durch Sichtbarwerden neuer Aspekte der Partner_in: „Wie gut kennen wir uns eigentlich?“
- Trauer um Aspekte, die Attraktion ausgemacht haben, und bei denen jetzt klar wird, dass die Partner_in sich unwohl mit diesen fühlt
- Sorge um Belastung von gemeinsamen Kindern durch die Umbrüche
Wichtig ist: Jede emotionale Reaktion auf ein Coming Out ist valide. Sie dürfen erleichtert und zugewandt, aber auch überfordert, enttäuscht oder wütend sein, oder erstmal Raum für sich brauchen. Nicht in Ordnung sind beleidigende, abwertende oder gewalttätige Reaktionen gegenüber ihrer Partner_in. Entscheidend ist wie in jeder sozialen Sitution, wie sie mit ihren Emotionen umgehen. Finden Sie einen Weg, Ihren Gefühlen Raum zu geben, z.B. durch Kontakt zu Beratungsstellen, Angehörigengruppen, Gespräche mit Freund_innen oder in künstlerischem Ausdruck (Schreiben, Malen …), Zeit für sich alleine zum Nachdenken… Häufig ist das Gespräch in der Partnerschaft in dieser Phase herausfordernd, weil die Partner_in Sorgen vor Ihrer Reaktion hatte oder insgesamt gerade einen starken Umbruch erlebt. Das muss nicht heißen, dass sie ihre Gefühle der Belastung nicht äußern dürfen – z.T. kann aber ein moderierter Rahmen helfen.
Herausforderungen können z.B. abgemildert werden, indem Sie….
- sich Raum und Zeit nehmen, Emotionen zu verarbeiten
- auf ihre eigenen Grenzen und die der Partner_in achten
- ins Gespräch gehen: „Was bedeutet das für unsere Beziehung?“ „Wo sind Herausforderungen?“ „Was trägt die Beziehung weiterhin?“ „Was brauchen wir jetzt beide, um uns gesehen und wertgeschätzt zu fühlen?“ „Was gibt uns beiden gerade Kraft und Bestärkung?“
- sich über TIN Themen informieren und Wissen gewinnen
- neue Perspektiven auf den_die Partner_in oder die Beziehung zulassen
- sich Unterstützung durch Vertraute und_oder queere Beratungsstellen suchen
- sich mit anderen Partner_innen austauschen
- auch Gemeinsamkeiten in den Blick nehmen: Häufig ist es hilfreich, die Umbrüche als eine gemeinsame Herausforderung zu sehen. Auch ein gemeinsames Hobby oder Aktivitäten, die ihre Beziehung stärken, können helfen, sich neu kennenzulernen und zu entdecken, was weiterhin verbindet.
- Bei gemeinsamen Kindern: Überlegen Sie zusammen, wie sie die Veränderung gut vermitteln können und Ängste nehmen, z.B. versichern, dass beide Elternteile weiterhin unterstützend sein werden, Familienaktivitäten stärken…
Nicht immer lassen sich auseinandergehenden Bedürfnissen überbrücken und Lebensumbrüche können immer auch zur Beendigung von Partnerschaften führen. Sollten Sie merken, dass Sie die Beziehung nicht oder nicht in dieser Form weiterführen können, ist das ebenso valide. Sollte es zu einer Trennung kommen: Versuchen Sie, auch diesen Prozess gemeinsam zu gestalten. Eine Trennung muss kein Scheitern bedeuten, sondern kann auch einen Neuanfang für beide bedeuten. Nehmen Sie sich auch hier Raum, um ihre Gefühle, z.B. Verlust und Trauer, da sein zu lassen und für sich eine neue Perspektive zu finden.
Unterstützung als bzw. für Eltern
Eltern und Angehörige von geschlechtskreativen Kindern und TIN Jugendlichen finden hier eine umfangreiche Liste von Beratungs- und Unterstützungsangeboten:
Informationen für TIN Jugendliche, geschlechtskreative Kinder, Eltern und andere Angehörige
Wichtig ist, dass sie ihr Kind ernst nehmen und im Gespräch bleiben – was braucht ihr Kind, um einen entspannteren Alltag leben zu können und sich als Mensch gesehen und wertgeschätzt zu fühlen? Was brauchen Sie, um diese Unterstützung gut geben zu können und mit evtl. Veränderungen gut umgehen zu können?
Nehmen Sie sich Zeit für ihren Prozess und suchen Sie sich Räume und Aktivitäten, die ihre Beziehung stärken – sei es das gemeinsame Aufsuchen einer Beratungsstelle oder einer Selbsthilfe-Gruppe oder ein gemeinsames Hobby, dass Ihnen Kraft und Zuversicht gibt. Achten Sie auch auf Ihre eigenen Grenzen. Oft ist es hilfreich, Räume zum Austausch finden, in denen sie mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen wie sie, reden können.
Infos für Arbeitgebende und Kolleg_innen
Was können Arbeitgeber_innen und Kolleg_innen tun?
Machen Sie sich bewusst, dass es sich bei einem Coming Out am Arbeitsplatz in erster Linie nicht um eine „Offenbarung des Privatlebens“ handelt, sondern um eine Mitteilung der_s Arbeitnehmenden bzgl. notwendiger Grundlagen, um gut arbeiten zu können.
Häufig sind die spezifischen Bedarfe von TIN Arbeitnehmer_innen an ihren Betrieb nicht hoch:
– Nutzung des neuen Namen und Pronomens
-> rechtlich auch bei Verträgen erlaubt (siehe Link unten)
– Schutz vor Diskriminierung und Anfeindung im Betrieb
– niedrigschwellige Möglichkeit, eine Toilette zu nutzen
– Gleichbehandlung bzgl. Beförderungen und Bezahlung
– bestehenbleibende Wertschätzung von Kompetenzen
Während des Transitionsprozesses können sich besondere Bedürfnisse ergeben, z.B. Ausfallzeiten wegen medizinischer Maßnahmen oder Wünsche nach einem geschützeren Rahmen mit weniger Kund_innenkontakt. Setzen Sie jedoch keine Bedürfnisse voraus, sondern gehen Sie ins Gespräch mit der Kolleg_in, wie sie jetzt gut unterstützen können.
Stellen Sie keine persönliche Fragen nach Operationen, Therapie, Partnerschaft o.ä., die dem Arbeitskontext unangemessen sind, sondern signalisieren Sie allgemein Ansprechbarkeit bei evtl. aufkommenden Bedarfen.
Wichtig: Beachten Sie den Datenschutz und erzählen nicht im Betrieb vom Comingout, ohne vorher Absprache mit der Kolleg_in bzgl. ihrer/seiner Bedarfe zu halten. Wenn gewünscht und für Sie machbar, übernehmen Sie die Mitteilung an Kolleg_innen oder begleiten entsprechende Gespräche.
Wollen Sie als Arbeitgeber gezielt TIN Personen als Angestellte werben, können diese Maßnahmen sehr positiv aufgenommen werden:
– Einrichtung geschlechtsneutraler Toiletten, z.B. Einzeltoiletten, durch Kabinen getrennte Toiletten, Auswahlmöglichkeit zwischen mehreren Toiletten o.ä.
– Ansprechstelle bei Diskriminierung im Betrieb
-> evtl. gemeinsamen Beratungsprozess bei einer TIN Beratungsstelle ermöglichen
– Nutzung des gewählten Namens und Pronomens
– Weiterbildung im Betrieb zum Thema
– Nutzung von geschlechtlich inklusiver Sprache bei Ansprache des Teams
– Beachtung von Zugänglichkeit bei Betriebsausflügen o.ä., z.B. wenn Sporträume genutzt werden
Weiterführende Ressourcen:
Broschüre „Trans am Arbeitsplatz“ (Deutsche Schriftsprache)
Broschüre „Trans in der Arbeitswelt“ (Deutsche Schriftsprache)
Broschüre „Trans Visible – Trans* und Arbeitsmarkt“ (Deutsche Schriftsprache)
Broschüre „Geschlechtliche Vielfalt im Öffentlichen Dienst“ (Deutsche Schriftsprache)
Tipps für Arbeitgeber*innen von der DGTI (Deutsche Schriftsprache)
Infos für Fachkräfte
pädagogische und soziale Bereiche
Lehrer_innen, Pädagog_innen und Fachkräfte im Sozialbereich sind häufig Ansprechpartner_innen für junge TIN Personen im Coming Out, begleiten diese und ihre Angehörigen in ihrer Entwicklung oder vermitteln Themen rund um Geschlechtergerechtigkeit und Diversität in ihrer Einrichtung.
Dabei stehen sie häufig vor Herausforderungen, weil Weiterbildungen, Fach- oder Unterrichtsmaterialien schwer zu finden sind, Ansprechpartner_innen der Profession fehlen oder das Thema Geschlechtergerechtigkeit Konflikte in der Organisation hervoruft.
Gesundheitsbereich
Therapeut_innen und Fachkräfte im Medizinischen Bereich können TIN Personen in vieler Hinsicht begleiten: Als Fachkräfte zu TIN Gesundheitsthemen und Transition oder als Unterstützer_innen bei allgemeinen Gesundheitsthemen, von Vorsorge über Behandlung von Krankheiten bis hin zur Begleitung von Schwangerschaften.
Auch bei Themen, die nicht TIN spezifisch sind, z.B. Trauma-Therapie, gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen oder zahnärztliche Behandlung, ist der Zugang zum Gesundheitssystem für viele TIN hochschwellig, was zu mangelnder Vorsorge und Unterstützung bei Erkrankungen führen kann. Zu dieser mangelnden Versorgung gibt es mittlerweile verschiedene Studien, z.B. der Schwulenberatung Berlin.
Dabei gibt es verschiedenes Wissen und Umgangsweisen, mit der der Zugang niedrigschwelliger gestaltet werden kann:
- respektieren Sie die Pronomen und den Namen von TIN Patient_innen, z.B. beim Aufrufen in der Praxis und der persönlichen Ansprache, auch wenn dieser noch nicht offiziell geändert wurde
- Nehmen Sie TIN Patient_innen in ihrer Identität und der Schilderung von Bedarfen und Erkrankungssymptomen ernst
- Nehmen Sie die Vielfalt von TIN Personen ernst, TIN Sein kommt in allen Gemeinschaften, allen Altergruppen und mit allen möglichen anderen Identitätsanteilen und Erfahrungen vor
- Informieren Sie sich über Bedarfe von TIN Personen in ihrem jeweiligen Feld, z.B. Krankheitssymptome, die sich hormonell bedingt unterscheiden (z.B. Herzinfarkt), besondere Bedarfe im gynäkologischen/urologischen Feld, sensibler therapeutischer Umgang
- Beachten Sie, dass viele TIN Personen bereits schlechte und z.T. traumatisierende Erfahrungen im Medizinsystem gemacht haben, z.B. Fehldiagnose psychischer Erkrankungen, Zwangsbehandlung von inter* Personen, und TIN Patient_innen daher z.T. erst im späteren Krankheitsverlauf einen Praxis aufsuchen oder besonders sensible Behandlung benötigen
- Behandlungen und Untersuchungen können, z.B. im urologisch/gynäkologischen Bereich aufgrund von Körperdysphorie sehr belastend sein für TIN Patient_innen: Nehmen Sie Rücksicht und üben Sie keinen Druck aus
- Wenden Sie sich bei grundsätzlichen Fragen zu TIN Themen an informierte Kolleg_innen oder TIN Beratungsstellen, fordern Sie keine Fortbildungsarbeit von ihren Patient_innen
Falls Sie grundlegende Offenheit und Sensibilität gegenüber TIN Patient_innen, und ggf. spezifisches Fachwissen mitbringen, können Sie ihre Praxis, zB. mithilfe einer der folgenden Websiten, gezielt für diese Patient_innen-Gruppe bewerben:
Für Mediziner_innen und Therapeut_innen: https://queermed-deutschland.de/
Für Gynäkolog_innen: https://gynformation.de/
Verhaltensweisen, die den Zugang zur Gesundheitsversorgung blockieren:
- TIN Sein pathologisieren und als zu behebende_s Krankheit(s-Symptom) sehen
- TIN-spezifische Gesundheitsversorgung als Ursache aller gesundheitlichen Probleme sehen, z.B. bei einer Magendarmerkrankung als erstes die Hormoneinnahme als Ursache vermuten
- Diskrimierende Äußerungen, z.B. dass TIN Sein nur ein aktueller Trend wäre
- Übergriffige Fragen, z.B. nach Genitaloperationen, dem alten Namen, belastenden Diskriminierungserfahrungen
- Körperlich und z.T. sexuell übergriffiges Verhalten, z.B. Aufforderung, sich auszuziehen, um Operationsergebnisse zu zeigen, ungefragtes Anfassen
- Ausschluss von TIN Personen aus der Praxis, z.B. keine Behandlung von TIN Personen, weil eine gynäkologische Praxis auf Schwangerschaft spezialisiert ist, auch wenn die TIN Person eine Schwangerschaft plant
- Verallgemeinerungen von TIN Erfahrungen, z.B. „alle trans Personen brauchen eine Genital-OP“, STI Testung aufdrängen, abwehrende Reaktion bei Kinderwunsch
- Unprofessionelle Kommentierung der Patient_in und ihrer Erfahrungen, z.B. „bei Ihnen hätte ich das ja nicht gedacht“, „ich hab da auch mal was im Fernsehen gesehen…“
- Besondere Diskriminierung mehrfachmarginalisierter TIN, zB. „wenn sie abnehmen, fühlen sie sich bestimmt wohler als Frau“, „wollen Sie das in ihrem Alter wirklich noch machen“
- Nicht-Ernstnehmen der Erfahrungen oder Symptomschilderungen von be_hinderten/ neurodiversen und_oder von migrantisierten/ BIPoC TIN, z.B. „die Patientin versteht das ja gar nicht, was sie da sagt“, „die Person möchte nur Aufmerksamkeit“
Weitere Hinweise zur Aufbau einer inklusiven Behandlungspraxis und medizinischen Ausschlüssen:
- Achten Sie auf die Gestaltung barrierearmer Praxisräume, z.B. Ausbau von Rollstuhlzugänglichkeit, Informationsmaterial in Braille-Schrift, Ausstattung mit Anti-Virus-Luftfiltern zum Schutz immunvulnerabler Patient_innen
- Wissen um Bedarfe von BIPoC Patient_innen: Viele Untersuchungsmethoden und Behandlungen sind auf weiße Patient_innen ausgerichtet und führen bei Schwarzen Patient_innen und Patient_innen of Color zu Fehl-Diagnostik oder mangelnden Untersuchungs-/ Behandlungsergebnissen, z.B. Beurteilung von Hautverletzungen und Erkrankungen, Beurteilungen von Krankheitsheitssymptomen, die sich auf der Haut zeigen, Haarentfernung mit älteren Laser-Geräten, Messung von Sauerstoffsättigung mit Pulsiometer, Messung von Hirnströmungen oder Beurteilung von Röntgenergebnissen. Zudem werden die Symptomschilderungen von BIPoC Patient_innen häufig weniger ernstgenommen, was zum Ausbleiben von Behandlungen führen kann. Ebenso kann auch Diskriminierung im Bereich der Sexualmedizin erfolgen.
- Ebenso, wie TIN Patient_innen häufig die Erfahrung machen, dass ihre Krankheitssymptome auf ihr TIN Sein oder geschlechtsangleichende Versorgung zurückgeführt werden, machen auch Patient_innen, die neurodivers sind, dick, oder behindert werden, häufig die Erfahrungen, dass jede Krankheit auf dieses Merkmal zurückgeführt wird, z.B. ein gehörloser Patient eine Praxis wegen einer Halserkrankung aufsucht, aber zunächst eine Ohr-Untersuchung durchgeführt wird.
- Auch die Schilderungen von Frauen werden häufig weniger ernst genommen oder z.B. Stimmungsschwankungen und Konzentrationsschwäche direkt als menstruationsbedingt vermutet. Oder Patient_innen werden falsch behandelt, weil ein Herzinfarkt mit Östrogen im Körper andere Symptome aufweist. Auch viele Studien orientieren sich primär an cis und endo-geschlechtlichen Männern und lassen cis und trans Frauen, trans Männer, sowie nicht-binäre und inter* Patient_innen außer Acht.
Vernetzung im therapeutischen und medizinischen Bereich
1) VLSP*
Der VLSP ist ein Verband lesbischer, schwuler, bisexuelle, trans, intersexueller und queerer Menschen in der Psychologie. Sie bieten Ansprechbarkeit bei Fachfragen, Fortbildungen, Fachmaterialien und die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.
2) Qualitätszirkel
2.1) Gesundheitsversorgung von trans*, inter* und nicht binären Kindern und Jugendlichen
Unter Beteiligung der Charite Berlin.
Ansprechperson:
Dr. med. Marie-Christine Reinert
FÄ f. Kinder- und Jugendmedizin
marie-christine.reinert@amedesgroup.com
2.2) Online Qualitätszirkel für Psychotherapeut_innen der DGTI
Die Ziele des Qualitätszirkels Psychotherapeut*innen sind die Verbesserung der psychologischen Versorgung und Begleitung von trans*, inter* und nicht-binären (TIN*) Patient*innen bzw. Klient*innen, der Austausch unter Fachkolleg*innen wie auch mit den erfahrenen Berater*innen der dgti.
Findet regelmäßig alle 2 Monate statt, online über Teams.
2.3) Interdisziplinärer Qualitätszirkel Transidentität
Broschüre des Netzwerk
Website
Ansprechpartner:
Dipl.-Psych. Günther Schon
Psychologischer Psychotherapeut
030 / 77 326 200
3) Fortbildungen im Waldschlösschen
Die Akademie Waldschlösschen in Göttingen bietet ein großes Fortbildungsangebot rund um queere und TIN Themen, auch zu spezifisch therapeutischen und medizinischen Themen.
4) Fortbildungsangebot bei TrIQ
Kontakt: fortbildung@transinterqueer.org
Medizinische Richtlinien bzgl geschlechtsangleichender Maßnahmen
S-3 Leitlinien
Aktuelle Richtlinien zur Kostenübernahme des MDS
Fachliteratur, Vernetzung und weitere Ressourcen für Therapeut_innen und medizinische Fachkräfte
Diskriminierung und Krisen
Wo finde ich akut Hilfe?
Bei TrIQ kann leider keine akute Krisenberatung oder Antidiskriminierungs- oder Rechtsberatung angeboten werden – hier findet ihr jedoch eine Liste mit Anlaufstellen, die euch in diesen Fällen unterstützen können:
Therapie und Medizinisches
Wie finde ich TIN*sensible Therapeut_innen?
Die Versorgungslage bzgl. spezialisierter und/oder sensibilisierter Therapeut_innen und Ärzt_innen ist sehr gering und es muss leider mit langen Wartenzeiten gerechnet werden.
Anbei eine Auswahl an Suchmaschinen, bei denen queer*, trans* und inter*sensible Therapeut_innen, Ärzt_innen etc. gelistet sind:
1. https://transdb.de/
2. https://queermed-deutschland.de/
3. https://translist.de/
4. https://www.gynformation.de/
Häufig sind psychotherapeutische Ausbildungsinstitute gute Anlasufstellen. Dort behandeln Personen, die sich noch in Ausbildung befinden und regelmäßig von ausgebildeten Psychotehrapeut_innen supervidiert werden. Dort sind die Wartezeiten meist geringer als in niedergelassenene Praxen. Außerdem ist die Chance dort etwas größer, an queer* sensible Therapeut_innen zu geraten. Wichtig zu wissen: nicht alle Ausbildungsinstuitute stellen Indikationsschreiben aus. Solltest du dies benötigen, frag am besten direkt bei Kontaktaufnahme nach. Anbei eine Liste:
https://praxis-etz.com/wp-content/uploads/2023/02/Liste-Ambulanzen-Erwachsene.pdf
Am besten benennst du direkt bei Kontaktaufnahme, was du suchst (z.B. Begleittherapie, Indikationsschreiben, etc.). Dann ist die Chance größer, dass du einer Person zugetreilt wirst, die zu dir passt.
Was ist für mich medizinisch sinnvoll?
Manche Personen benötigen medizinische Maßnahmen, um sich in ihrem Körper wohlfühlen zu können. Dies ist nicht immer mit identären Fragen verbunden. Unsere Beratungsstelle erhält z.B. auch immer wieder Anfragen von cis Frauen, die sich schon lange Jahre eine Mastektomie wünschen, ohne dass dies ihre Geschlechtsidentität in Frage stellt.
Informed Consent – gut informiert einwilligen
Wie der Prozess der Identitätsfindung ist auch der Prozess, passende medizinische Möglichkeiten für sich zu finden, sehr individuell:
Manche TIN Personen wissen schon seit der Kindheit, der Pupertät oder der Identitätsfindung, welchen körperlichen Veränderungen sie sich wünschen. Manche wissen schon immer, dass ihr Körper sich so wie er ist, genau richtig anfühlt. Andere haben im Laufe ihres Lebens unterschiedliche Bedürfnisse gehabt.
Manchmal verändern auch eine begonne medizinische oder soziale Transition, oder einfach die Veränderungen im Leben die Bedürfnisse: Eine nicht-binäre Person merkt, dass sie sich zwar schon länger eine Mastektomie gewünscht hat, aber sie sich durch Testosteron so viel wohler fühlt, dass diese keine Rolle mehr spielt. Oder eine trans Frau hat lange gedacht, dass sie nie eine Genital-OP möchte – nach einigen Jahren wird das Thema aber doch wichtig für sie.
Wichtig ist, wie bei der Identitätsfindung, sich Zeit zu lassen für den eigenen Prozess, sich gut zu informieren und auszutauschen und sorgfältig die Möglichkeiten und Risiken abzuwägen.
Tipps für den Prozess:
1) Infos sammeln
– Tausch dich mit Personen aus, die bereits eine Behandlung gemacht haben, die du in Erwägung ziehst
– Tausch dich mit Personen aus, die über die gleichen Behandlungen nachdenken oder nachgedacht haben: Was ist für sie wichtig dabei? Was bereitet ihnen Sorgen? Worauf freuen sich sich?
– Sprich mit Ärzt_innen und Chirug_innen und lass dich über Risiken und Möglichkeiten aufklären
– TIN Beratungsstellen können dir i.d.R. viele Infos mit auf den Weg geben
2) Innerer Prozess
– Überlege, was deine Ziele und deine Sorgen bei der Entscheidung sind – was macht dir Sorgen, gibt es etwas, worauf du dich freust?
– Vielleicht gibt es eine Methode, mit der du dich und deinen Prozess besonders gut ausdrücken kannst, z.B. schreiben, eine Collage machen, malen, tanzen – dann kannst du diese auch hier nutzen!
– Such dir einen Freiraum, um entspannt nachdenken zu können – ein Wochenende allein auf dem Land, ein langes Gespräch mit eine_r Freundin, Spaziergänge …
– Falls du eine Therapeut_in hast, mit der du diese Themen besprechen möchtest/kannst, kann Therapie ein sehr hilfreicher Raum für diese Prozesse sein
Bei der Planung einer geschlechtsangleichenden Operation gibt es viele Faktoren zu beachten:
- Welche operativen Möglichkeiten gibt es grundsätzlich?
- Welche Varianten der einzelnen OPs werden angeboten?
- Welche Risiken und längerfristigen Folgen müssen bedacht werden?
- Welche Zielsetzung habe ich bei den OPs? -> Was soll sich verändern? Was soll gleich bleiben?
- Sind meine Erwartungen realistisch umsetzbar?
- Mit welchem Krankenhaus und Chirurg_in fühle ich mich wohl?
- Wie kann ich mich gut vor- und nachbereiten?
3) Dauerhaft wirkende Eingriffe sorgfältig abwägen
Alle dauerhaft wirkenden Eingriffe sollten sorgfältig abgewogen werden.
Dies gilt gerade für Operationen im Genitalbereich: Bei einer Entfernung der Hoden oder des Uterus wird das persönliche Zeugen oder Gebären eines Kindes unmöglich. Zudem ist die_der Patient_in anschließende auf eine dauerhafte Versorgung mit von hormonenellen Medikamenten angewiesen, um eine gleichbleibende Funktion des Stoffwechsels zu gewährleisten. Genital-Operationen haben auch ein erhöhtes Risiko für Komplikationen, z.B. das Korrektur-Eingriffe nötig sein können, Penetration nur eingeschränkt möglich ist, oder es zu Gefühls-Verlust im Genitalbereich kommt.
Das Risiko, lebenslang auf eine Hormon-Medikamentation angewiesen zu sein, besteht auch bei einer Hormontherapie, da diese evtl. die körpereigene Hormonproduktion dauerhaft außer Kraft setzt.
Eine Mastektomie führt i.d.R. dazu, dass Stillen später nicht mehr möglich ist, weil das Drüsengewebe entfernt wird. Je nach Methode der Mastektomie besteht auch (hohe) Wahrscheinlichkeit, dass es zu Gefühlsverlust im Bereich der Nippel kommt.
Vor diesen medizinischen Maßnahmen sollten daher diese Fragen sorgfältig durchdacht werden:
- Möchte ich gerne ein Kind gebären, stillen oder zeugen? Falls ich einen Kinderwunsch habe, ist mir leibliche Elternschaft wichtig? Oder möchte ich mir diesen auf andere Art und Weise, z.B. Schwangerschaft der Partner_in, Pflegekindschaft, Adoption, Co-Parenting o.ä. erfüllen?
- Kann ich mir vorstellen, hormonelle Medikamente u.U. mein Leben lang zu nehmen?
- Bei Mastektomie und Genital-OPs: Kann ich einen Umgang damit finden, falls es zu Gefühlsverlust kommt oder es Schwierigkeiten im sexuellen Bereich gibt?
- Kann ich einen Umgang damit finden, falls mich das OP Ergebnis nicht ausreichend zufrieden stellt oder Korrektur-OPs benötigt werden?
Falls sich später andere körperliche und_oder soziale Bedürfnisse entwickeln, können einige geschlechtsangleichende Maßnahmen zum Teil wieder reduziert werden, z.B. durch eine Hormonbehandlung mit dem ursprünglich produzierten Hormon, Entfernung von Haaren durch Laser, Logopädie, um eine höhere Stimmlage zu erreichen, oder die Reduktion oder Aufbau einer Brust. Viele Effekte bleiben aber dauerhaft bestehen. Solltest du dich zum Thema Re-/ Detransition näher informieren oder austauschen wollen, findest du dazu Ressourcen weiter oben in diesem FAQ.
Hormontherapie
TrIQ e.V. hat eine Broschüre zum Thema Hormontherapie für trans und nicht-binäre Menschen herausgebracht, in der ihr die wichtigsten Infos zum Thema findet:
Hormonbroschüre (deutsch + englisch, PDF):
https://www.transinterqueer.org/angebote/publikationen/informationsmaterial/
Chirurgische Eingriffe
Im Folgenden findet ihr ein kurze Übersicht, welche geschlechtsangleichenden Operationen in Deutschland angeboten werden, Infos zur Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen und verschiedene Ressourcen rund ums Thema. Zur weiteren persönlichen Beratung wendet euch bitte an unsere oder eine andere TIN Beratungsstelle.
Fragen bei der Planung einer geschlechtsangleichenden Operation:
- Welche operativen Möglichkeiten gibt es grundsätzlich?
- Welche Varianten der einzelnen OPs werden angeboten?
- Welche Risiken und längerfristigen Folgen müssen bedacht werden?
- Welche Zielsetzung habe ich bei den OPs? -> Was soll sich verändern? Was soll gleich bleiben?
- Sind meine Erwartungen realistisch umsetzbar?
- Mit welchem Krankenhaus und Chirurg_in fühle ich mich wohl?
- Wie kann ich mich gut vor- und nachbereiten?
Übersicht über geschlechtsangleichende Operationen
Brustbereich:
Mastektomie -> Formung einer flachen Brust
Brustaufbau und -vergrößerung
Gesicht:
FFS (Female Feminisation Surgery) -> sog „Gesichtsfeminisierung“
Tracheal Shave -> Adamsapfel-Verkleinerung
Genitalbereich:
Neovulva -> Formung einer Vulva aus bisher vorhandem Genitalgewebe
Orchiektomie -> Entfernung der Hoden
Klitpen -> Formung eines kleinen Penis aus bisher vorhandenem Genitalgewebe
Neophallus -> Formung eines Penis aus transplantiertem Gewebe
Hodenprothesen/ Einsetzung einer Erektionspumpe in den Neophallus
Hysterektomie -> Entfernung des Uterus
Die meisten dieser OPs können, insofern die Auflagen erfüllt sind, von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Orchiektomie wird in Deutschland i.d.R. nur im Rahmen einer Neovulva-OP durchgeführt. Bei FFS ist die Kostenübernahme bisher nur in Einzelfällen möglich gewesen.
Folgende weitere operative Möglichkeiten werden selten durchgeführt:
– Operative Stimmfeminisierung
-> nachdem logopädische Mittel ausgeschöpft sind
– Gesichtsmaskulinierung
-> wird vereinzelt von Plastischen Chirurg_innen angeboten (keine Kostenübernahme)
Kostenübernahme
Die aktuellen Regelungen des Medizinischen Dienstes Bund (MDS) zur Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen findet ihr hier. Der MDS ist die Überorganisation der Medizinischen Dienste der Krankenkassen (MDK), die über die Kostenübernahme von planbaren Behandlungen entscheiden.
Private Krankenkassen können eigene Regelungen zur Kostenübernahme haben, diese sind z.T. mit mehr Auflagen verbunden oder auch niedrigschwelliger zugänglich.
Auf Seite 35 der MDS Richtlinie steht zum Therapiezeitraum:
„Bei genitalangleichenden Operationen ist für die Alltagserfahrungen – bezugnehmend auf die SoC –i.d.R. ein Zeitraum von mindestens 12 Monaten zu fordern, um eine vollinformierte soziale und medizinische Transition zu ermöglichen und das Risiko für Bedauern („regrets“) und
Retransitionen zu minimieren. Abweichungen davon müssen von den
Behandelnden nachvollziehbar begründet werden. Einzelne Maßnahmen,
z.B. Epilationsbehandlung, Hormonbehandlung oder Mastektomie, können
auch schon zu einem früheren Zeitpunkt erforderlich sein, um die
Alltagserfahrungen zu ermöglichen. Auch dies muss von den Behandelnden
begründet werden (s. Kapitel 2.5.6).“
Für Operationen im Genitalbereich ist i.d.R. ein Therapie-Zeitraum von 12 Monaten nötig, für Mastektomien, Epilationsbehandlungen und Tracheal Shave i.d.R. 6 Monate. Bei Kostenübernahme für Brustaufbau und FFS muss die individuelle Notwendigkeit besonders ausführlich nachgewiesen werden.
Reguläre Unterlagen, die vom MDK zur Kostenübernahme verlangt werden:
- Nachweis Ausschluss Inter*geschlechtlichkeit (weil sonst andere Abrechnung/ Bedingungen)
-> Diese Bescheinigung wird i.d.R. von Urolog_innen, Gynäkolog_innen, Endokrinolog_innen oder Hausärzt_innen ausgestellt - Therapienachweis und therapeutische Indikation
- Bei Brustaufbau: Nachweis einer Hormontherapie
- Nachweis eines Vorgesprächs zur entsprechenden Operation in einem Vertragskrankenhaus
- kurzer persönlicher Bericht, warum die OP benötigt wird
Inklusion nicht-binärer Menschen und aktuelles Gerichtsurteil
Wichtig: Bisher gelten die Kostenübernahme-Richtlinien der Krankenkassen nicht für nicht-binäre Menschen, obwohl die AWMF S3 Leitlinie diese inkludiert. Die „Leitlinien“ der AWMF sind systematisch entwickelte Hilfen für Ärzt_innen zur Entscheidungsfindung in spezifischen Situationen.
Nach dem Urteil des Bundessozialgerichts am 19.10.2023 muss der G-BA neu über die Kostenübernahme, sowohl für nicht-binäre als auch für sich als binär männlich o. weiblich verstehende trans* Personen neu entscheiden. Das Urteil begründet sich darin, dass bisher noch keine Kostenrichtlinie für partizipative, d.h. in individueller Absprache zwischen Patient_in und Mediziner_innen getroffene Behandlungswege bestünde.
Entgegen Befürchtungen nach der Urteilsverkündung scheint die Kostenübernahme für binäre trans* Personen jedoch momentan weiterhin wie gehabt zu erfolgen. Hier findet ihr die Stellungsnahmen des BVT und der TIN Rechtshilfe.
Ressourcen rund um OPs und Kostenübernahme:
Patient_innen-Leitfaden zur S3 Leitlinie des BVT
Praxistipps zur Kostenübernahme des BVT
Beschwerde-Musterschreiben des BVT bei Problemen mit der Kostenübernahme
Medizinische Richtlinien bzgl geschlechtsangleichender Maßnahmen
S-3 Leitlinien
Aktuelle Richtlinien zur Kostenübernahme des MDS
Weitere Möglichkeiten
Neben Hormontherapie und Operationen gibt es weitere Möglichkeiten, das körperliche Erleben zu verändern. Im Folgenden ein kurzer Überblick:
Haarentfernung
Die Entfernung von Körperhaaren wird eingeschränkt von der Krankenkasse übernommen:
Bei transfemininen Persone wird sie im Gesichtsbereich und an den Armen übernommen.
Bei transmaskulinen Menschen, die einen Penoidaufbau planen, wird Haarentfernung an der Körperstellt (i.d.R. Arm oder Oberschenkel) übernommen, wo das Gewebe zur Transplantation übernommen wird.
Es gibt 2 verschiedene Methoden der dauerhaften Haarentfernung: Haarentfernung mittels Laser (Laser-Epilation) und mittels Elektroepilation, zumeist Nadel-Epilation genannt.
Da Laserepilation i.d.R. bestimmte Kontraste zwischen Haar- und Hautfarbe vorraussetzt, nämlich dunkle Haare, helle Haut, ist diese Methode für viele Menschen unzugänglich.
Im Falle der Nadelepilation besteht leider eine Versorgungslücke: Die Behandlung wird nur dann von den Krankenkassen bezahlt, wenn sie in einer Arztpraxis durchgeführt wird – es gibt jedoch fast keine Arztpraxen, die diese Methode anbieten. Es gibt jedoch zahlreiche private Anbieter_innen, i.d.R. Kosmetiker_innnen, die diese Behandlung durchführen.
Logopädie
Mittlerweile haben sich verschiedene logopädische Praxen auf die Begleitung von trans* Personen spezialisiert. Die Begleitung kann dabei sowohl während einer Hormontherapie erfolgen als auch unabhängig von dieser.
Ziel ist zumeist, sich mit der eigenen Stimme und Sprechweise wohler zufühlen. Dazu kann es sowohl hilfreich sein, den eigenen Stimmumfang und Sprechrythmus kennenzulernen und auszuschöpfen, als auch, diesen mithilfe von Übungen zu verändern. Logopädische Übungen können auch das Sprechen vor Gruppen erleichtern und das Selbstbewusstsein und die Wahrnehmung der eigenen stimmlichen Fähigkeiten stärken. Auch Begleitung von Sänger_innen innerhalb einer Stimmveränderung durch Hormonveränderung ist ein häufiges Ziel.
Epithesen
Epithesen sind eine Variante von Prothesen, die primär eine ästhetisch-soziale Funktion haben. Sie können sowohl den Verlust eines Körperteils durch Krankheit oder Unfall erträglicher machen als auch das Körperbild vervollständigen, wenn bestimmte Körperteile nicht ausgebildet wurden.
Im Bereich von geschlechtsangleichenden Möglichkeiten sind dies primär Brust- oder Penis-Epithesen.
Epithesen sind dabei i.d.R. wasserfest und für viele Alltagsaktivitäten wie Sport geeignet.
Für Träger_innen von Brust-Epithesen gibt es spezifische Schwimmmode und BHs, die Sport ohne Bewegungseinschränkungen ermöglichen. Die Anfertigung von Epithesen kann von der Krankenkasse übernommen werden, ebenso gibt es viele frei verkäufliche Modelle.
Penis-Epithesen können – je nach Modell – auch das Urinieren im Stehen ermöglichen oder für Sex genutzt werden. Die nicht-medizinische Variante einer Penis-Epithese wird häufig „Packer“ genannt, das Tragen dieser „Packing“. Auch für Penis-Epithesen und Packer gibt es spezifische Schwimm- und Unterwäsche, die Bewegungsfreiheit ermöglicht.
Perücken
Bei Menschen, deren Körper längere Zeit Testosteron produzieren oder zugeführt bekommen, kann dieses zu epigenetisch bedingtem Haarausfall führen, der von außen als „männlich“ gelesen wird: Haarausfall am Haaransatz über den Schläfen, kreisrunder Haarausfall oder insgesamt verdünntes Haar. Ursache ist Dihydrotestosteron (DHT), ein Stoffwechselprodukt von Testostron.
Im Falle einer Hormontherapie mit Östrogen bzw. Testosteronblockern können sich diese Effekte verringern, lassen sich jedoch i.d.R. nicht rückbilden. Sollte dies zu einer starken Belastung im sozialen Alltag führen, können die Kosten für eine Perücke von der Krankenkasse übernommen werden.
Tucking
Als Tucking (übersetzt: Verstauen) werden Methoden bezeichnet, mit denen – häufig transfeminine – Menschen ein flaches Erscheinungsbild in ihrer Unterwäsche erzielen. Es gibt auch spezifische Tucking-Unterwäsche. Die Kosten werden z.T. von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Das Queer-Lexikon hat eine Broschüre zum Thema Tucking veröffentlicht.
Binder
Ein Binder ist eine Art Kompressions-Shirt, mit dem – häufig transmaskuline – Menschen ein flaches Erscheinungsbild ihres Oberkörpers erzielen. Die Kosten werden z.T. von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Das Queer-Lexikon hat eine Broschüre zum Thema Binder veröffentlicht, ebenso die DGTI.
Vor- und Nachbereitung bei chirurgischen Eingriffen
Tipps für die Vor- und Nachbereitung von Operationen
- Sprich mit anderen aus der Community, die bereits diese Operation gemacht haben oder lies dir Erfahrungsberichte durch – besonders hilfreich sind oft spezifische Berichte zum Krankenhaus und dem Service dort
- Frag beim Vorgespräch mit den Chirurg_innen: Was kann ich zur Vor- und Nachbereitung machen? Gibt es etwas, was ich ins Krankenhaus mitbringen soll?
- Sprich mit deiner Hausärzt_in und_oder Gynäkolog_in/Urolog_in vor Ort: Kann die Praxis dich nach deiner Operation unterstützen? Oft bieten die chirurgischen Center auch Beratung per Mail oder Telefon an, lokale Unterstützung, z.B. zum Fädenziehen oder bei Schwellungen ist dennoch sehr hilfreich.
- Manchmal gibt es spezifische Angebote zur Vor- und Nachbereitung in Community Anlaufstellen oder spezifische Infotermine für eine bestimmte Operation
- Überleg dir: Was brauche ich für einen längeren Krankenhausaufenthalt? Was wird mir dort helfen, mich entspannter oder besser zu fühlen?
- Community-Support: Gibt es jemanden, der mich zur OP begleiten kann oder nach dieser mit mir in Austausch steht? Gibt es jemanden, der mich nach der OP entlasten kann, z.B. im Haushalt oder emotional? Falls du keine Person im Umfeld hast, kannst du in TIN Gruppen oder anderen Vernetzungen nach Unterstützung fragen.
Weiterführende Ressourcen:
Poster und Begleitheft: Trans*Körper*Wahrnehmung – Ressourcen rund um die Mastektomie (de/en) von Alexander Hahne www.alexanderhahne.com und K* Stern www.praxis-kstern.de
Änderung von Vornamen und Geschlechtseintrag
Wie kann ich meinen Namen und/oder Geschlechtseintrag ändern?
TrIQ Beratung zur Namens- und Personenstands (= Geschlechtseintrags) Änderung:
Zum Thema Namens- und Personenstandsänderung gibt es bei TrIQ ein spezialisiertes Beratungsangebot, dort sind entsprechende Fragen am besten aufgehoben: [LINK]
TIN Migrant_innen: TrIQ bietet auch spezialisierte Beratung für geflüchtete TIN an, hier findet ihr Insta und die Website. Menschen, die spezifische Fragen zu Änderungen von nicht-deutschen Ausweisen haben, können sich auch an Miles, GLADT oder LesMigraS wenden, diese Organisationen sind auf die Beratung von queeren Migrant_innen spezialisiert.
DGTI* Ergänzungsausweis
Von der Website der DGTI: Der dgti-Ergänzungsausweis ist ein standardisiertes Ausweispapier, das alle selbstgewählten personenbezogenen Daten (Vorname, Pronomen und Geschlecht) dokumentiert und ein aktuelles Passfoto zeigt. Bei sämtlichen Innenministerien, bei der Polizei, vielen Behörden, Banken, Universitäten, Versicherungen und anderen Stellen ist er bekannt und akzeptiert. Dort, wo dies noch nicht der Fall ist, hilft ein QR-Code auf dem Ausweis weiter.
https://www.dgti.org/ergaenzungsausweis.html
Möglichkeiten der Namens- und Personenstandsänderung
Es gibt momentan 2 Möglichkeiten, den Vornamen und den Geschlechtseintrag ändern zu lassen: Das TSG (Transsexuellengesetz) und den Paragraph 45b Personenstandsgesetz.
1) TSG
Eine Möglichkeit, den Namen und den Geschlechtseintrag zu ändern, ist über das sog. TSG (Transexuellen-Gesetz).
Das TSG ist ein altes Gesetz und soll schon seit Jahrzehnten überarbeitet werden, was bisher leider nicht geschehen ist. Daher sind die Vorgaben hier hoch.
Es werden 2 psychologische Gutachten benötigt und die Änderung muss beim Gericht beantragt werden, wo man persönlich zu eine_m Richter_in muss. In Berlin erfolgt der Besuch bei der zuständigen Richterin in der Regel vor der Erstellung der Gutachten. Die Richterin hat Erfahrung im Umgang mit trans Personen, bisher gab es noch keine negativen Rückmeldungen.
Die Kosten sind hoch. Es gibt jedoch die Möglichkeit, Prozesskostenhilfe zu beantragen, dann werden die Gutachten dadurch bezahlt. Bei geringem Einkommen wird diese Prozesskostenhilfe in der Regel gewährt.
Informationen zur Prozesskostenhilfe: https://www.berlin.de/gerichte/was-moechten-sie-erledigen/artikel.418028.php
Ansonsten gibt es zwei Möglichkeiten:
a) Zwei Gutachten durch gerichtlich akzeptierte Gutachter_innen erstellen lassen und direkt mit dem Antrag einreichen. In dem Fall muss man i.d.R. pro Gutachten etwa 300-500€ einplanen.
b) Dem Gericht einen Vorschuss für die Gutachten zu bezahlen (ca. 1500€ in Berlin), das Gericht gibt dann die Gutachten in Auftrag. Es können dabei zwei Gutachter_innen gewünscht werden -> wir haben eine Liste mit gerichtlich anerkannten, trans-erfahrenen Gutachter_innen.
Momentan dauert es in Berlin ca. ein halbes Jahr, bis die Bearbeitung durch ist, mit Prozesskostenhilfe u.U. länger.
Hier findet ihr weitere Infos dazu, wie die Beantragung funktioniert:
http://transmann.de/trans-informationen/rechtliches/
2) 45b Personenstandsgesetz/ 3. Option
Diese Option steht laut dem aktuellesten Gerichtsurteil momentan nur inter* Menschen offen!
Du brauchst von einer Arztpraxis einen Attest, auf dem steht, dass bei dir eine „Variante der Geschlechtsentwicklung“ vorliegt. Damit kannst du beim Bürgeramt den Namen & Geschlechtseintrag ändern lassen. Es kostet eine Bearbeitungsgebühr von ungefähr 25€.
Weitere Infos findest du und deine Ärzt*in hier:
https://www.lsvd.de/recht/ratgeber/intersexuelle/ratgeber-fuer-inter-und-transgeschlechtliche-menschen.html
Mit dem Bescheid vom Gericht oder Bürgeramt kann dann der Personalausweis und Reisepass und daraufhin auch andere Dokumente, Zeugnisse usw. geändert werden. Um die Änderung der Dokumente (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) muss man sich selbst kümmern, d.h. auch dafür muss jeweils ein Termin beim Bürgeramt gemacht werden. Mit dem Bescheid, sowie dem neuen Personalausweis (oder Reisepass/ Führerschein) können dann auch Zeugnisse, Bankkarten, Mitgliedsausweise, Mitverträge usw. geändert werden. Damit es dabei nicht zu Problemen kommt, empfehlen wir, Fotos vom alten Personalausweis zu machen, bevor dieser eingezogen wird (da man nicht zwei Personalausweise gleichzeitig haben kann).